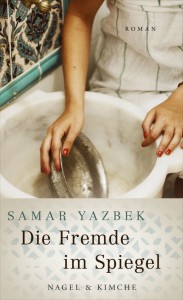Wenn ich mich manchmal frage, warum mir im Alltag der Kopf wirbelt und ich den Wald vor Bäumen nicht sehe, liegt es oft daran, dass ich mich von zu vielen verlockenden Optionen umgeben sehe. Zu viel Auswahl, ein zu grosses Angebot an Ähnlichem, die bekannte Qual der Wahl. Dass das überhaupt ein Problem ist, zeigt, in welchem Wohlstand wir leben… Ich stelle schon seit längerem fest, dass ich den grossen Edeka, an dem ich auf dem Heimweg direkt dran vorbei fahre, lieber links liegen lasse und zu dem kleinen, altmodischen in unserer Siedlung gehe. Ich habe das Gefühl, ich brauche allein schon von der puren Laufstrecke durch den Laden länger, wenn ich in den gigantischen gehe, und ausserdem macht mich das Überangebot an gleichartigen Produkten leicht verrückt. (Und geht es nur mir so, aber – je mehr Joghurtsorten im Kühlregal, desto unauffindbarer die Hefe?)
Wenn ich mich manchmal frage, warum mir im Alltag der Kopf wirbelt und ich den Wald vor Bäumen nicht sehe, liegt es oft daran, dass ich mich von zu vielen verlockenden Optionen umgeben sehe. Zu viel Auswahl, ein zu grosses Angebot an Ähnlichem, die bekannte Qual der Wahl. Dass das überhaupt ein Problem ist, zeigt, in welchem Wohlstand wir leben… Ich stelle schon seit längerem fest, dass ich den grossen Edeka, an dem ich auf dem Heimweg direkt dran vorbei fahre, lieber links liegen lasse und zu dem kleinen, altmodischen in unserer Siedlung gehe. Ich habe das Gefühl, ich brauche allein schon von der puren Laufstrecke durch den Laden länger, wenn ich in den gigantischen gehe, und ausserdem macht mich das Überangebot an gleichartigen Produkten leicht verrückt. (Und geht es nur mir so, aber – je mehr Joghurtsorten im Kühlregal, desto unauffindbarer die Hefe?)
Mit den Kleidern ist es ähnlich: wer kennt nicht das Gefühl vor dem vollen Kleiderschrank, nichts anzuziehen zu haben. Seit ich je nach Jahreszeit eine andere Auswahl aus meinem Schrank auf die Kleiderstange hänge und den Rest wegräume, tue ich mich leichter. Meine Sommergarderobe ist eher klein. Fünf Kleider, die ich schon beim Kaufen geliebt habe, zwei Röcke, eine Hose und ein paar Oberteile. Jedes Jahr freue ich mich, diese Sachen wieder zu sehen. Und weil man sie nur acht bis zehn Wochen tragen kann, sieht man sich auch nicht satt daran. Ganz anders als mit der Herbst/ Wintergarderobe, der man nach gefühlten 30 Wochen einfach nichts mehr abgewinnen kann. Im März neige ich zu den gefürchteten impulsiven Fehlkäufen… Aber das nur am Rande. Es tut gut und vereinfacht das Leben, sich auf ein paar Farben und gut kombinierbare Teile zu beschränken. Ich empfinde es nicht als Beschränkung, sondern eher als Befreiung, weil ich nicht viel über das, was ich anziehen will, nachdenken muss. Beziehungsweise: einmal intensiv nachgedacht spart später Zeit.
Und lässt einen mehr Zeit haben für andere Organisationsaufgaben nach dem gleichen Motto: jetzt dranbleiben mit Block und Stift und eine Auswahl treffen, um späteren Stress zu vermeiden. Die Idee, die ersten Stunden des neuen Schuljahrs in den letzten Wochen des alten zu planen, wenn man gedanklich noch mittendrin ist, habe ich von Frances Clark, einer geschätzten amerikanischen Klavierlehrerin. Wie genial das ist, habe ich erst kapiert, als ich es das erste Mal gemacht habe. Seit einigen Jahren verfahre ich nun so und freue mich schon direkt auf meine Planungsstunde. Völlig stressfrei breite ich meine ganzen Unterlagen und mögliche neue Hefte auf dem Tisch aus, natürlich mit (mehr als) einer Tasse Tee, und überlege Schüler für Schüler, wie es im neuen Jahr weitergeht, welche Noten eventuell angeschafft werden müssen (Extraliste auf einem anderen Block) und was wir in der ersten Stunde machen. Das ist das Geheimnis für Seelenruhe über die Ferien schlechthin: schon mal skizzieren, wie es losgeht und die entsprechenden Hefte einpacken. Meine Erdinger Schüler werde ich in der ersten Woche mit einhändigen Stücken beglücken – das ist ein lustiger Anfang, aussderdem klingt es so, als sei es leichter… Die Kekskrümel und Taschentücher von einem halben Jahr sind aus meiner Schultasche entfernt, die geplanten ersten Stunden und die Hefte dafür sind drin, und ich spüre schon jetzt einen wunderbaren Seelenfrieden, bevor ich die Kinderchen überhaupt in die Sommerferien verabschiedet habe. Nächste Woche plane ich die Stunden meiner Privatschüler, dann kommt die Mega- Notenbestellung, und dann – Cocktails, Strandparties, der weisse Raffaelo – Werbungs – Badeanzug, was man als Klavierlehrerin halt so macht in den Sommerferien. Nein, nicht wirklich. Aber gefühlt!