Der Blog bekommt ein neues Zuhause – bitte hier entlang:
www.martinasommerer.wordpress.com
Die alten Artikel von 2009 – 2017 sind weiterhin hier zugänglich.
Ich freue mich auf Euren Besuch!
Der Blog bekommt ein neues Zuhause – bitte hier entlang:
www.martinasommerer.wordpress.com
Die alten Artikel von 2009 – 2017 sind weiterhin hier zugänglich.
Ich freue mich auf Euren Besuch!
 Häuser waren für mich schon immer Persönlichkeiten. Ich erinnere mich an manche Gebäude, in denen ich als Kind aus und ein gegangen bin, wegen des Gefühls, das mich sofort eingehüllt hat, wenn ich die Schwelle überschritten hatte. Ein typischer, einzigartiger und unbeschreiblicher Geruch oder ein dämmriger Flur, in den die Sonne ein bestimmtes Dreieck aus Licht warf sind für immer mit den Personen verbunden, die in diesen Häusern lebten. Eins gehörte untrennbar zum Anderen. Und selbst wenn die Menschen, die diese Häuser gebaut haben, schon lange zu Staub geworden sind, spürt man ihre Gegenwart in ihren Gemäuern. Manchmal, weil es ohnehin geschichtsbeladene Orte sind, die heute der Öffentlichkeit zugänglich sind; manchmal weht einen ein Hauch von früher an, ohne dass man irgendwas über das Gebäude weiss. Und genau so unerklärlich ist es, warum man sich in manchen Häusern spontan wohlfühlt und in anderen quasi immer über die Schulter schauen will, weil die Geister gar zu unsympathisch sind. Warum man manche Wohnungen ablehnt, auch wenn Lage und Preis in Ordnung wären (ich hab mal eine Wohnung besichtigt, in der ich nur gesträubte Haare hatte – die Maklerin pries sie an, als ob alles wunderbar wäre, und die Sonne schien, aber ich erfuhr erst danach und durch Zufall, dass eine verblutete Leiche eine Woche in dieser Wohnung gelegen hatte. Eine Woche!! Und das war zwei Monate vor der Besichtigung!) Und es gibt auch den seltsamen Fall, dass Häuser mit einer eigentlich unguten Geschichte eine positive Ausstrahlung haben können – da fragt man sich, ob wir mit unserem nur vorübergehenden Dasein Häusern unseren Stempel doch nicht so stark aufdrücken können, dass sie davon beeinflusst werden. Die Steine überdauern uns und sind vielleicht doch unabhängig von dem, was sich in ihnen abgespielt hat. Und die ursprünglich gute Idee, die jedem Bau vorangeht, ist vielleicht stärker als das, was sich dann darin abgespielt hat.
Häuser waren für mich schon immer Persönlichkeiten. Ich erinnere mich an manche Gebäude, in denen ich als Kind aus und ein gegangen bin, wegen des Gefühls, das mich sofort eingehüllt hat, wenn ich die Schwelle überschritten hatte. Ein typischer, einzigartiger und unbeschreiblicher Geruch oder ein dämmriger Flur, in den die Sonne ein bestimmtes Dreieck aus Licht warf sind für immer mit den Personen verbunden, die in diesen Häusern lebten. Eins gehörte untrennbar zum Anderen. Und selbst wenn die Menschen, die diese Häuser gebaut haben, schon lange zu Staub geworden sind, spürt man ihre Gegenwart in ihren Gemäuern. Manchmal, weil es ohnehin geschichtsbeladene Orte sind, die heute der Öffentlichkeit zugänglich sind; manchmal weht einen ein Hauch von früher an, ohne dass man irgendwas über das Gebäude weiss. Und genau so unerklärlich ist es, warum man sich in manchen Häusern spontan wohlfühlt und in anderen quasi immer über die Schulter schauen will, weil die Geister gar zu unsympathisch sind. Warum man manche Wohnungen ablehnt, auch wenn Lage und Preis in Ordnung wären (ich hab mal eine Wohnung besichtigt, in der ich nur gesträubte Haare hatte – die Maklerin pries sie an, als ob alles wunderbar wäre, und die Sonne schien, aber ich erfuhr erst danach und durch Zufall, dass eine verblutete Leiche eine Woche in dieser Wohnung gelegen hatte. Eine Woche!! Und das war zwei Monate vor der Besichtigung!) Und es gibt auch den seltsamen Fall, dass Häuser mit einer eigentlich unguten Geschichte eine positive Ausstrahlung haben können – da fragt man sich, ob wir mit unserem nur vorübergehenden Dasein Häusern unseren Stempel doch nicht so stark aufdrücken können, dass sie davon beeinflusst werden. Die Steine überdauern uns und sind vielleicht doch unabhängig von dem, was sich in ihnen abgespielt hat. Und die ursprünglich gute Idee, die jedem Bau vorangeht, ist vielleicht stärker als das, was sich dann darin abgespielt hat.
 Ich suche grade etwas verkopft nach Argumenten, warum ich mich in einem Haus mit einer besonderen und seltsamen Geschichte so ausserordentlich wohl fühle. Denn anfangs wusste ich nichts über das Haus, in dem ich seit Monaten regelmässig aus und ein gehe. Ich kenne es schon seit Jahren von Besuchen und Essenseinladungen und fand es von der ersten Sekunde an unglaublich gemütlich und einladend. Es ist eine grosszügige, flache Villa im Dreissigerjahrestil in einem noch grosszügigeren Grundstück. Zur Strassenseite hin ist sie eher unscheinbar und fällt nicht weiter auf, aber zum Garten hin öffnet sie sich in einem ganz breit gezogenen Halbrund. Überhaupt fand ich den Grundriss immer leicht seltsam und undurchschaubar bei Besuchen. Inzwischen hab ich die grosse Haustour hinter mir und weiss mehr über das Gebäude, und da die Entwürfe und Zeichnungen in einem Wiener Architekturarchiv für jedermann einsehbar sind, erlaube ich mir, hier drüber zu schreiben in der Hoffnung, die Privatsphäre der Bewohner trotzdem zu wahren (immer diese Gratwanderung beim Blogschreiben!) Das eindrucksvolle Anwesen wurde von Lois Welzenbacher entworfen, einem österreichischen Architekten, der 1889 geboren wurde und seine Hauptschaffenszeit vor dem zweiten Weltkrieg hatte. Welzenbacher entwarf hauptsächlich Häuser für den alpinen Raum, und er liebte es, die Gebäude mit oft ungewöhnlichen Grundrissen organisch in die Landschaft einzufügen. Das Wasserburger Haus ist ganz typisch für seine Vorgehensweise: an der höchsten Stelle, von der Strasse her eher abweisend, zur Aussichtsseite hin grandios und offen. Das Haus hier steht an einem der höchsten Punkte Wasserburgs und bietet im Winter, wenn die Bäume kahl sind, eine unglaubliche Sicht auf den Fluss und alles, was sich an der anderen Seite darüber erhebt.
Ich suche grade etwas verkopft nach Argumenten, warum ich mich in einem Haus mit einer besonderen und seltsamen Geschichte so ausserordentlich wohl fühle. Denn anfangs wusste ich nichts über das Haus, in dem ich seit Monaten regelmässig aus und ein gehe. Ich kenne es schon seit Jahren von Besuchen und Essenseinladungen und fand es von der ersten Sekunde an unglaublich gemütlich und einladend. Es ist eine grosszügige, flache Villa im Dreissigerjahrestil in einem noch grosszügigeren Grundstück. Zur Strassenseite hin ist sie eher unscheinbar und fällt nicht weiter auf, aber zum Garten hin öffnet sie sich in einem ganz breit gezogenen Halbrund. Überhaupt fand ich den Grundriss immer leicht seltsam und undurchschaubar bei Besuchen. Inzwischen hab ich die grosse Haustour hinter mir und weiss mehr über das Gebäude, und da die Entwürfe und Zeichnungen in einem Wiener Architekturarchiv für jedermann einsehbar sind, erlaube ich mir, hier drüber zu schreiben in der Hoffnung, die Privatsphäre der Bewohner trotzdem zu wahren (immer diese Gratwanderung beim Blogschreiben!) Das eindrucksvolle Anwesen wurde von Lois Welzenbacher entworfen, einem österreichischen Architekten, der 1889 geboren wurde und seine Hauptschaffenszeit vor dem zweiten Weltkrieg hatte. Welzenbacher entwarf hauptsächlich Häuser für den alpinen Raum, und er liebte es, die Gebäude mit oft ungewöhnlichen Grundrissen organisch in die Landschaft einzufügen. Das Wasserburger Haus ist ganz typisch für seine Vorgehensweise: an der höchsten Stelle, von der Strasse her eher abweisend, zur Aussichtsseite hin grandios und offen. Das Haus hier steht an einem der höchsten Punkte Wasserburgs und bietet im Winter, wenn die Bäume kahl sind, eine unglaubliche Sicht auf den Fluss und alles, was sich an der anderen Seite darüber erhebt.
Ich mochte das Haus von Anfang an, weil ich eine Schwäche für farbige Fensterläden und überhaupt alte, gerundete Fenster und Fensterbänke habe. (Egal, welche Jahreszeit: ich sehe da immer Chancen für adventliche Dekoration mit schlichtem Tannengrün und Kerzen.) Und der Eingangsbereich ist grosszügig und gemütlich, wie eine Umarmung. Und die wunderschönen alten Dielen und die Schiebetür zum Wohnzimmer, in dem wir Klavier spielen, und die Terrassentüren neben dem Klavier, und die Holztreppe in den ersten Stock mit den unterschiedlich bemalten Stufen – alles strahlt eine Wärme, Geborgenheit und Gemütlichkeit aus, die moderne Häuser nie haben können.
 Ende des letzten Winters fingen meine Bekannte und ich an, ernsthaft Klavierduo zu üben. Bei den ersten Proben war der Garten kahl und leer. Wenn ich kam, prasselte ein Feuer im Ofen, und wochenlang musste ich als erstes den Regenschirm ausschütteln und aufstellen. Nach der Regenzeit tauchten die ersten Tränenkrüglein büschelweise auf an der Terrassentür neben dem Flügel, auf dem ich immer spiele. Dann die Osterglocken und Tulpen. Dann kam der Frühsommertag, an dem wir zum ersten Mal die Türen offen liessen, weil es so angenehm war. Dann kam die Hitze, und an einem heissen Julimorgen, als ich auf dem kurzen Spaziergang schon fast verschmachtete, empfing mich das Haus kühl, schattig und winddurchweht: buchstäblich alle Türen waren offen, in alle Himmelsrichtungen. Aus dem parkähnlichen Garten kamen leichte Lüftchen, die Kugeln an einem der Kronleuchter wackelten im Wind und eine Amsel machte wirklich und wahrhaftig wiederholt einen Rhythmus aus unserem Brahms nach. Ich bin es überhaupt nicht gewöhnt, bei offenen Fenstern Musik zu machen, aber durch die Alleinlage des Gebäudes stört man keinen, und es ist eigentlich der reinste Luxus, so inmitten der Natur Klavier zu spielen. Und noch mehr als im Winter hatte ich das Gefühl, dass die beiden riesigen Flügel wie Schiffe sind, an denen wir – weit voneinander entfernt – wie zwei (mehr oder weniger planvoll vorgehende…) Kapitäne sitzen und dass wir vielleicht, wenn es besonders schön läuft, irgendwann auf den Wogen unserer Musik runter in den Inn gleiten können und da weiter schwimmen…
Ende des letzten Winters fingen meine Bekannte und ich an, ernsthaft Klavierduo zu üben. Bei den ersten Proben war der Garten kahl und leer. Wenn ich kam, prasselte ein Feuer im Ofen, und wochenlang musste ich als erstes den Regenschirm ausschütteln und aufstellen. Nach der Regenzeit tauchten die ersten Tränenkrüglein büschelweise auf an der Terrassentür neben dem Flügel, auf dem ich immer spiele. Dann die Osterglocken und Tulpen. Dann kam der Frühsommertag, an dem wir zum ersten Mal die Türen offen liessen, weil es so angenehm war. Dann kam die Hitze, und an einem heissen Julimorgen, als ich auf dem kurzen Spaziergang schon fast verschmachtete, empfing mich das Haus kühl, schattig und winddurchweht: buchstäblich alle Türen waren offen, in alle Himmelsrichtungen. Aus dem parkähnlichen Garten kamen leichte Lüftchen, die Kugeln an einem der Kronleuchter wackelten im Wind und eine Amsel machte wirklich und wahrhaftig wiederholt einen Rhythmus aus unserem Brahms nach. Ich bin es überhaupt nicht gewöhnt, bei offenen Fenstern Musik zu machen, aber durch die Alleinlage des Gebäudes stört man keinen, und es ist eigentlich der reinste Luxus, so inmitten der Natur Klavier zu spielen. Und noch mehr als im Winter hatte ich das Gefühl, dass die beiden riesigen Flügel wie Schiffe sind, an denen wir – weit voneinander entfernt – wie zwei (mehr oder weniger planvoll vorgehende…) Kapitäne sitzen und dass wir vielleicht, wenn es besonders schön läuft, irgendwann auf den Wogen unserer Musik runter in den Inn gleiten können und da weiter schwimmen…
 Unser vielzitiertes und bei vielen Tassen Tee geplantes Hauskonzert wabert aber noch in unsicherer Ferne. Vor allem, weil meine Partnerin nach dem Klavierstudium noch was Vernünftiges studiert hat und schlicht und einfach keine Zeit zum Üben hat. Den Willen schon, und die Lust auch, aber ich verstehe ihr Zeitproblem absolut. Und dann, weil wir eben nicht nur üben… Sondern auch gern reden. Über das Haus zum Beispiel. Und da kam Erstaunliches raus – oder vielleicht doch nicht, bei einem Haus, das in den Dreissigerjahren gebaut wurde? Es wurde in Auftrag gegeben von einem Wasserburger Nazi – Oberfunktionär, der dann hier wohnte und auch Bürger empfing und so. Man kann sich vorstellen, dass hier wirklich haarsträubende Dinge besprochen wurden – aber mir sträuben sich die Haare nicht. Gar nicht. Der Architekt hat vielleicht so viel Gutes hier reingesteckt, dass die schlimme Zeit davon überdeckt wird. Und es wurde ja seither mit vielfältigem anderen Leben gefüllt, vielleicht hat das auch was für die Aura des Hauses getan.
Unser vielzitiertes und bei vielen Tassen Tee geplantes Hauskonzert wabert aber noch in unsicherer Ferne. Vor allem, weil meine Partnerin nach dem Klavierstudium noch was Vernünftiges studiert hat und schlicht und einfach keine Zeit zum Üben hat. Den Willen schon, und die Lust auch, aber ich verstehe ihr Zeitproblem absolut. Und dann, weil wir eben nicht nur üben… Sondern auch gern reden. Über das Haus zum Beispiel. Und da kam Erstaunliches raus – oder vielleicht doch nicht, bei einem Haus, das in den Dreissigerjahren gebaut wurde? Es wurde in Auftrag gegeben von einem Wasserburger Nazi – Oberfunktionär, der dann hier wohnte und auch Bürger empfing und so. Man kann sich vorstellen, dass hier wirklich haarsträubende Dinge besprochen wurden – aber mir sträuben sich die Haare nicht. Gar nicht. Der Architekt hat vielleicht so viel Gutes hier reingesteckt, dass die schlimme Zeit davon überdeckt wird. Und es wurde ja seither mit vielfältigem anderen Leben gefüllt, vielleicht hat das auch was für die Aura des Hauses getan.
Und jetzt machen wir auch noch Musik zur Aura – Optimierung, wenn wir nicht Tee trinken. Da die Haydn – Variationen, an denen wir zugegeben den grössten Spass haben, für meine Partnerin mit ihren kleinen Händen sehr schlecht liegen, hab ich sie aufgefordert, das nächste Stück vorzuschlagen. Nach kurzem Überlegen meinte sie: „Ravel, La Valse?“ Und ich entgegnete mit professioneller Miene: „Hm, ja, Ravel, warum nicht?“ (Und innerlich: „ja ja ja!! Soll ich die Noten besorgen? Wann fangen wir an? Welche Stimme soll ich üben? Können wir sofort jetzt gleich anfangen, bitte?“ Ich bin wirklich unschuldig an diesem Ravel!)
Fotos: Archiv für Baukunst und Austria – Forum; Häuser in Linz, Barbiano und Zell am See
 Wer mich kennt, weiss, dass ich theoretisch keine Bücher mehr anschaffen will. Aus Platzgründen.
Wer mich kennt, weiss, dass ich theoretisch keine Bücher mehr anschaffen will. Aus Platzgründen.
Wer mich besser kennt, weiss auch, dass ich es trotzdem immer wieder tue. Irgendwann muss ich einfach neue Regale aufstellen, damit diese Gewissenskonflikte mal aufhören.
In letzter Zeit musste ich aber aus Altruismus Bücher kaufen. Es gibt ein wunderbares, höhlenartiges, total vollgestelltes Antiquariat in einem der ältesten Häuser in Wasserburg, in dem ich wahnsinnig gern stöbere. Der einzige Weg, der Versuchung zu entgehen, war, eben nicht mehr hinzugehen. Aber dann traf ich den Buchhändler im Winter in einem Konzert. Wir unterhielten uns danach noch etwas und er klagte mir sein Leid: er bekommt eine Heizung und muss den einen Teil seines Ladens komplett ausräumen. Im Prinzip ist es ja angenehm, im 21. Jahrhundert eine Heizung zu haben (ich habe wirklich gestaunt, dass es in Wasserburg noch Häuser ohne Heizung gibt. Klingt wie tiefstes Osteuropa, oder? Erklärt vielleicht auch den wunderbar muffigen Geruch, den ich so mag.) Aber diese Berge von Büchern auszuräumen – mir graut bei dem Gedanken. Um irgendwie durchzukommen, veranstaltete der Buchhändler einen Sonderverkauf und meinte zum Abschied, so nebenbei: „Sie können ja mal vorbeischauen.“
Und so flammte unsere verhängnisvolle Affäre wieder auf.
Herr Feurer entspricht auch optisch der Vorstellung, die man von einem schöngeistigen promovierten Kunsthistoriker und Germanist, der jetzt Buchhändler ist, hat: gross und hager und fast acht Monate im Jahr in einem langen schwarzen Mantel und Schal. Sieht immer aus, als wäre er auf dem Weg zu einer Beerdigung, aber jetzt weiss ich, dass es wegen der nicht – existenten Heizung ist. Irgendwann sagte er von sich selbst, dass er äusserst graecophil sei (musste schnell nachschauen, wie man’s schreibt…), und ab da gewann unsere Beziehung noch mal an Tiefe. Seit mein Vater nicht mehr da ist, vermisse ich einen Gesprächspartner über die antike Welt sehr schmerzlich. Und jetzt, nachdem ich meine Besuche im Antiquariat wieder aufgenommen habe, merke ich, wie sehr ich unsere Unterhaltungen vermisst habe, sein profundes Wissen über vergangene Zeiten und obskure Quellen, sein Engagement, entlegenere Sekundärliteratur für mich aufzuspüren, seine liebevoll kopierten Literaturlisten mit noch mehr Quellen, die mich interessieren könnten (obwohl das schon fast was von einem Drogendealer hat – einmal verführt, gibt’s den immer noch besseren Kick, den immer noch reineren Stoff. Und ich kann nicht nein sagen.), seine Überzeugung, dass es keine vergriffenen Bücher gibt, sondern dass die sehr wohl noch irgendwo sein müssen… Ich muss wohl nicht erwähnen, dass ich nur zwei der Sonderverkaufsbücher erstanden habe. Und die auch noch als Geburtstagsgeschenke für andere – das klingt jetzt richtig schäbig, aber es sind zwei wirklich besondere und sehr passende Bücher für die jeweiligen Menschen. Der Rest der (undeutlich genuschelte Zahl) Bücher, die ich gekauft habe, waren gebundene, wunderschöne Exemplare, zum Teil Erstausgaben mit bibliophilen Vorsatzblättern – was einem halt so passiert, wenn man schwach wird.
 Auf die Graecophilie kamen wir, als wir über Klassiker redeten, die jeder kennt und keiner liest, und ich sagte so nebenbei, dass ich schon immer die Odyssee lesen wollte. Und er: ich kann Ihnen ja ein paar raussuchen, während Sie sich umgucken. Und man glaubt es nicht: er hatte einen ganzen Stapel von verschiedenen Ausgaben und Übersetzungen (erst wollte er mir das Original andrehen – äh!) und empfahl mir als Musikerin die vom Schiller – Zeitgenossen Voß, weil sie so einen schönen Rhythmus hat. Womit er völlig recht hat. Ich liebe auch diese altmodische Sprache. Keine Ahnung, wie nah sie am Original ist, aber wenn man schon was uraltes liest, ist es egal, ob man es in einer ebenfalls alten Brechung liest. Mir ist es auf jeden Fall nicht zu fern, und ich hatte das grösste Vergnügen seit langem, als ich mich über die letzten Wochen langsam und mit Genuss durch das Epos arbeitete. Wobei gegen Ende das Phänomen auftrat, das sicher jeder kennt: dass man noch langsamer und genussvoller liest, weil man nicht möchte, dass das Buch zu Ende geht. Was dazu führte, dass ich mich relativ lange in den blutrünstigen letzten Kapiteln aufhielt, in denen mit den Freiern aufgeräumt wird und die Mägde an Stricken aufgehängt werden, bis ihre Füsse nicht mehr zappelten… Das ist schon eher scheusslich. Aber die ganze lange Reise vorher, die lebendige Schilderung der fischdurchwimmelten Meere, die Morgendämmerung, die immer wieder mit rosigen Fingern erwacht – das war der allerbeste Crashkurs in antiker Weltanschauung. Ich erinnere mich, wie ich, als ich in dem Jahr in Amerika auch Kunstgeschichte belegt habe, als Pflichtlektüre ein dickes Buch über Mythologie lesen musste und mich damit etwas gequält habe (und vor allem dachte: was denn noch alles…) Wenn man die Odyssee liest, bekommt man die farbigste und lebendigste Vorstellung von der griechischen Götterwelt. Wie sie tatsächlich ständig vom Himmel steigen, in verschiedenen Gestalten, und ins Geschehen eingreifen. Und wie liebevoll und menschlich sie charakterisiert werden: Athene als blauäugichte, freundliche Tochter. Man freut sich schon immer auf die strahlenden Augen, wenn man spürt, jetzt ist mal wieder ihre Intervention fällig. Und es hat ja auch was ganz Märchenhaftes, wenn sie nachts als Rauch oder Nebel ganz fein durch einen Spalt der Türe kommen. Überhaupt war alles märchenhafter und lieblicher zu lesen, als ich je gedacht hätte. Und wirklich so, dass man denkt: noch eine Seite, nur noch eine, bevor ich das Licht ausmache! Noch ein paar Robben, Nymphen und Sirenen, bitte!
Auf die Graecophilie kamen wir, als wir über Klassiker redeten, die jeder kennt und keiner liest, und ich sagte so nebenbei, dass ich schon immer die Odyssee lesen wollte. Und er: ich kann Ihnen ja ein paar raussuchen, während Sie sich umgucken. Und man glaubt es nicht: er hatte einen ganzen Stapel von verschiedenen Ausgaben und Übersetzungen (erst wollte er mir das Original andrehen – äh!) und empfahl mir als Musikerin die vom Schiller – Zeitgenossen Voß, weil sie so einen schönen Rhythmus hat. Womit er völlig recht hat. Ich liebe auch diese altmodische Sprache. Keine Ahnung, wie nah sie am Original ist, aber wenn man schon was uraltes liest, ist es egal, ob man es in einer ebenfalls alten Brechung liest. Mir ist es auf jeden Fall nicht zu fern, und ich hatte das grösste Vergnügen seit langem, als ich mich über die letzten Wochen langsam und mit Genuss durch das Epos arbeitete. Wobei gegen Ende das Phänomen auftrat, das sicher jeder kennt: dass man noch langsamer und genussvoller liest, weil man nicht möchte, dass das Buch zu Ende geht. Was dazu führte, dass ich mich relativ lange in den blutrünstigen letzten Kapiteln aufhielt, in denen mit den Freiern aufgeräumt wird und die Mägde an Stricken aufgehängt werden, bis ihre Füsse nicht mehr zappelten… Das ist schon eher scheusslich. Aber die ganze lange Reise vorher, die lebendige Schilderung der fischdurchwimmelten Meere, die Morgendämmerung, die immer wieder mit rosigen Fingern erwacht – das war der allerbeste Crashkurs in antiker Weltanschauung. Ich erinnere mich, wie ich, als ich in dem Jahr in Amerika auch Kunstgeschichte belegt habe, als Pflichtlektüre ein dickes Buch über Mythologie lesen musste und mich damit etwas gequält habe (und vor allem dachte: was denn noch alles…) Wenn man die Odyssee liest, bekommt man die farbigste und lebendigste Vorstellung von der griechischen Götterwelt. Wie sie tatsächlich ständig vom Himmel steigen, in verschiedenen Gestalten, und ins Geschehen eingreifen. Und wie liebevoll und menschlich sie charakterisiert werden: Athene als blauäugichte, freundliche Tochter. Man freut sich schon immer auf die strahlenden Augen, wenn man spürt, jetzt ist mal wieder ihre Intervention fällig. Und es hat ja auch was ganz Märchenhaftes, wenn sie nachts als Rauch oder Nebel ganz fein durch einen Spalt der Türe kommen. Überhaupt war alles märchenhafter und lieblicher zu lesen, als ich je gedacht hätte. Und wirklich so, dass man denkt: noch eine Seite, nur noch eine, bevor ich das Licht ausmache! Noch ein paar Robben, Nymphen und Sirenen, bitte!
Es lässt sich nicht vermeiden, dass diese wundervolle Ausdrucksweise auch ins Alltagsleben sickert. Man fängt unwillkürlich an, in solchen Bildern zu denken. Unser Besuchskater, der seit neun Jahren täglich ein bis drei Mal bei uns vorbeischaut, scheint uns schon irgendwie zu mögen, zeigt das aber kein bisschen. Bisher hiess er „Pokerface“, weil er unsere Liebkosungen geduldig, aber mit quasi heruntergezogenen Mundwinkeln über sich ergehen liess. Seit ich Homer lese, teilt er mit Odysseus den Beinamen „der herrliche Dulder“. (Und erduldet sogar das mit stoischer Miene.) Und wenn ich gelegentlich kurz vor dem Ausflippen bin, gibt es keine innerlichen prosaischen Flüche mehr, sondern ich denke an Achilles, der „raufend mit eigenen Händen das Haupthaar entstellete“. Die edlere Variante, ohne Zweifel.
Warum liest das keiner? Wieso kommt man durch die Schule, ohne jemals damit in Berührung gekommen zu sein? Das Ding ist nicht umsonst seit 2800 Jahren in aller Munde. Und es ist tatsächlich der ganz besonders pure Stoff, der einem sensationelle Höhenflüge gibt.
Ich hab ja einen Doppelband gekauft, in dem die Ilias auch drin ist. Über die habe ich noch das andere Vorurteil – nicht endlos lang und keine Heimat in Sicht, sondern nur kämpfende Männer und zerstörte Städte. Das wird jetzt auch revidiert, hoffe ich. Der Anfang ist zwar viel zäher als die Odyssee, aber ich merke, dass ich Feuer gefangen habe. Und zwar daran, dass ich „Troia“ gegoogelt habe und erfahren habe: gibt’s zwar nicht mehr, aber die Ortszeit wäre eine Stunde später und es hat 22 Grad, fast wie bei uns. So was packt mich dann. Und auf einmal sind Hektor und Patroklos keine Krieger mehr, sondern Menschen, die mich ganz arg interessieren…
 Und der Sommerurlaub ist, dank obskurer Sekundärliteratur, auch schon geplant. Auslöser war Gilbert Highet’s „Poets in a landscape“ aus den 50er Jahren, ein Buch über römische Dichter und ihre Wohnorte, das mich so angesprochen hat, dass ich den Gatten, den anderen herrlichen Dulder (aber jetzt im wirklich homerischen Sinn) im Haushalt, dazu überredete, das Buch ganz einfach als Reiseführer zu nehmen. Es führt uns hauptsächlich in bekannte Gefilde in Latium – das ist ohnehin seine Lieblingslandschaft, dürfte also kein allzu grosses Opfer sein. Die Ferienwohnung ist schon gebucht und ich zappele schon vor Vorfreude, zwei Wochen ganz nah an Rom zu sein und meine alten Bekannten zuhause besuchen zu können. Ein anderer Italienfreund meint vorsichtig: schau mal nach, was da nach zweitausend Jahren noch steht, nicht dass du enttäuschst bist. Er hat leider ziemlich recht… Aber es geht ja auch um das Flair der Orte. Die Hügel, über die Horaz die Sonne untergehen sah, werden wohl noch ziemlich gleich sein, die Vegetation, der Geruch, die Vogelstimmen… Und für den Rest hab ich meine Phantasie.
Und der Sommerurlaub ist, dank obskurer Sekundärliteratur, auch schon geplant. Auslöser war Gilbert Highet’s „Poets in a landscape“ aus den 50er Jahren, ein Buch über römische Dichter und ihre Wohnorte, das mich so angesprochen hat, dass ich den Gatten, den anderen herrlichen Dulder (aber jetzt im wirklich homerischen Sinn) im Haushalt, dazu überredete, das Buch ganz einfach als Reiseführer zu nehmen. Es führt uns hauptsächlich in bekannte Gefilde in Latium – das ist ohnehin seine Lieblingslandschaft, dürfte also kein allzu grosses Opfer sein. Die Ferienwohnung ist schon gebucht und ich zappele schon vor Vorfreude, zwei Wochen ganz nah an Rom zu sein und meine alten Bekannten zuhause besuchen zu können. Ein anderer Italienfreund meint vorsichtig: schau mal nach, was da nach zweitausend Jahren noch steht, nicht dass du enttäuschst bist. Er hat leider ziemlich recht… Aber es geht ja auch um das Flair der Orte. Die Hügel, über die Horaz die Sonne untergehen sah, werden wohl noch ziemlich gleich sein, die Vegetation, der Geruch, die Vogelstimmen… Und für den Rest hab ich meine Phantasie.
 Heute war der zweite Tag seit einem Monat, an dem ich morgens nicht als erstes turbomässig üben musste. Vorgestern hatte ich noch ein Konzert, bei dem ich viel gespielt habe und den Nachmittag bis unmittelbar davor mit Proben verbracht habe. Und zum ersten Mal in meiner Laufbahn hatte ich tatsächlich Schmerzen – mir taten die Fingerkuppen weh, was komplett hysterisch klingt, zumindest habe ich noch nie von solchen Beschwerden gehört, und die Unterarme. Was plausibler ist. Das Komische ist, dass ich bei Sololiteratur noch nie Probleme hatte, egal, wie viel ich geübt habe. Wahrscheinlich war es die Anstrengung, ein ganzes Orchester vorzutäuschen, kombiniert mit dem Frust, dass es doch nie so klingt, wie man es sich vorstellt, und daraus folgend einem unmässigen Kraftaufwand. Auf jeden Fall merkte ich beim Aufwachen: ich bin ausgelaugt und irgendwie entmutigt, mit nur noch schwach flackernden Akkus. Da gibt’s nur eins: es muss gechillt werden, auch wenn Montag morgen ist.
Heute war der zweite Tag seit einem Monat, an dem ich morgens nicht als erstes turbomässig üben musste. Vorgestern hatte ich noch ein Konzert, bei dem ich viel gespielt habe und den Nachmittag bis unmittelbar davor mit Proben verbracht habe. Und zum ersten Mal in meiner Laufbahn hatte ich tatsächlich Schmerzen – mir taten die Fingerkuppen weh, was komplett hysterisch klingt, zumindest habe ich noch nie von solchen Beschwerden gehört, und die Unterarme. Was plausibler ist. Das Komische ist, dass ich bei Sololiteratur noch nie Probleme hatte, egal, wie viel ich geübt habe. Wahrscheinlich war es die Anstrengung, ein ganzes Orchester vorzutäuschen, kombiniert mit dem Frust, dass es doch nie so klingt, wie man es sich vorstellt, und daraus folgend einem unmässigen Kraftaufwand. Auf jeden Fall merkte ich beim Aufwachen: ich bin ausgelaugt und irgendwie entmutigt, mit nur noch schwach flackernden Akkus. Da gibt’s nur eins: es muss gechillt werden, auch wenn Montag morgen ist.
Also schleppte ich einen Stuhl zum Teich, zusammen mit hauchzartem chinesischem Tee (eine Begleiterscheinung, wenn man Zeugs für einen Klavierprofessor organisiert, der beruflich regelmässig in China zu tun hat – gestern hatten wir einen Besprechung wegen des Klaviersommers und er brachte mir drei wunderschöne Dosen mit verschiedenem Tee mit) und versenkte mich, eskapismusmässig, in die „Ilias“. Jetzt überholt ein Blogartikel den anderen, schon fertigen, aber – ich habe den grössten Spass daran, Homer zu lesen. Was ich nie erwartet hätte. Und ich bin bei allem grausamen Abschlachten oft berührt, wie poetisch Homer doch ist. Und deshalb lese ich weiter – manchmal ist es so arg, dass man unwillkürlich schneller liest und nicht so genau wissen will, aus welchem Winkel jener jetzt wieder von der Lanze durchbohrt wird und auch nicht, wo sie wieder austritt… Aber ich hab Feuer gefangen und will schon aus historischen Interesse alles lesen. Wobei ich ganz klar sagen muss: nötig ist das wirklich nicht. Auszüge würden reichen. Aber den legendären Schiffskatalog am Anfang sollte man sich mal geben… Und es ist immer wieder atemberaubend, wenn man bei allem Gemetzel auf eine Stelle trifft in der Art: „wie aufgeblühter Mohn, der vom Frühlingsregen schwer ist, neigte er den Kopf, und Nacht verhüllte seine Augen.“ (So ungefähr, das Buch liegt grad wo anders.)
Und wenn alle in den Staub stürzen und elend ums Leben kommen, erscheint das eigene Schicksal und das bisschen Klavierspielen sehr harmlos. Trotzdem musste ich mich aufraffen und mir gut zureden, den Frühlingsgarten mit den Akeleien, dem Kuckuck und den ersten zarten Libellen am Teich zu verlassen, mir ein Pausenbrot zu machen und eine frisch gebügelte Bluse anzuziehen. Montag ist immer ein furchtbar langer und lauter Tag. Aber ich wäre bereit dafür gewesen – nur mein Auto war es nicht. Wirklich und wahrhaftig, es streikte.
 Ich hastete vor zur Werkstatt – kein Leihwagen heute, tut ihnen leid, und so kann ich definitiv nicht fahren, das müssen sie erst mal anschauen. Nach einem leichten Panikanfall – ich hab nur ein Mal in zehn Jahren den Unterricht abgesagt! – trottete ich heim. Anfangs zerbrach ich mir furchtbar den Kopf, wie ich den Tag noch retten kann. Aber langsam sickerte eine Art Erkenntnis durch: was, wenn es einfach nicht sein soll? Was, wenn die Götter vielleicht beschlossen haben, dass ich mehr als genug Musik hatte in den letzten Wochen und mal eine ausserplanmässige Pause machen darf? Wenn man so viel antikes Zeug liest, in dem die Götter ständig eingreifen, oder eben nicht, fängt man an, so zu denken… Vielleicht hatte Apollo ein Einsehen und hat ein bisschen an meinem Auto manipuliert, damit ich morgen wieder Freude am Spielen habe?
Ich hastete vor zur Werkstatt – kein Leihwagen heute, tut ihnen leid, und so kann ich definitiv nicht fahren, das müssen sie erst mal anschauen. Nach einem leichten Panikanfall – ich hab nur ein Mal in zehn Jahren den Unterricht abgesagt! – trottete ich heim. Anfangs zerbrach ich mir furchtbar den Kopf, wie ich den Tag noch retten kann. Aber langsam sickerte eine Art Erkenntnis durch: was, wenn es einfach nicht sein soll? Was, wenn die Götter vielleicht beschlossen haben, dass ich mehr als genug Musik hatte in den letzten Wochen und mal eine ausserplanmässige Pause machen darf? Wenn man so viel antikes Zeug liest, in dem die Götter ständig eingreifen, oder eben nicht, fängt man an, so zu denken… Vielleicht hatte Apollo ein Einsehen und hat ein bisschen an meinem Auto manipuliert, damit ich morgen wieder Freude am Spielen habe?
Als ich wieder zuhause war, hatte ich mich in mein Schicksal gefügt (war dann gar nicht sooo schwer) und rief in der Schule an. Und dann meinen Kollegen oben im Musiktrakt, damit er eventuelle verwaiste Schüler, die die Durchsage nicht mitbekommen haben, heimschickt. Er konnte sich nicht verkneifen, zu bemerken, dass mir diese Autopanne anscheinend nicht wahnsinnig leid tue…
Und dann sass ich wieder am Teich. Bin in der „Ilias“ ein ganzes Stück weitergekommen und habe im Lauf des Tages drei Schwertlilien beim Aufblühen zugeschaut. Habe aber auch den Rasen gemäht – ein bisschen puritanische Arbeitsmoral darf schon noch sein. Aber – ich danke der höheren Gewalt! Das war eine grandiose Idee!
 Letzten Herbst habe ich den Klassenabend einer lieben Kollegin begleitet, und beim Verabschieden steckte sie mir einen Umschlag zu. Ich hatte eine nette Dankeskarte erwartet und war ganz erstaunt, als ich Belohnung in einer anderen und viel prosaischeren, aber nichtsdestotrotz nicht unwillkommenen Art fand: Kohle! Und zwar genau so viel, wie zwei der besten Karten fürs Münchner Konzert des Emerson – Quartett kosten würden! Ich hatte tagelang damit geliebäugelt, und jetzt waren die Würfel gefallen. Ich hatte mich um Streicher gekümmert, und dafür würden sich andere Streicher um meine Seele kümmern – und was für welche. Gleich am nächsten Morgen rief ich, noch im Bademantel, bei der Konzertagentur an und bestellte zwei Karten in der zweiten Reihe Mitte, direkt vor dem Quartett. (So was hatte ich noch nie gemacht. Macht ziemlich Spass, das auszusprechen!) Die gute Fee setzte uns wirklich brettlbreit vor die Notenständer – wir hatten zwei Spieler rechts, zwei links von uns und den sagenhaftesten, absolut optimalen Höreindruck. Möglicherweise waren akustische Gründe ausschlaggebend, aber die Musiker sassen auch noch ganz vorn an der Rampe, also höchstens zwei Meter von uns. In einem Klavierabend würde ich nie so einen Platz wählen, weil der Höreindruck zu direkt wäre. Ausserdem wäre es für mich kein Mysterium, was da vor sich geht, ich müsste nicht so genau hingucken. Bei Menschen, die ihren Ton selber produzieren, und noch auf so unglaublich zarte Art, bin ich endlos und nachhaltig fasziniert und muss alles auch genau sehen, nicht nur hören. Und ich will so nah wie möglich dran sein, um das Holz selber schwingen zu spüren.
Letzten Herbst habe ich den Klassenabend einer lieben Kollegin begleitet, und beim Verabschieden steckte sie mir einen Umschlag zu. Ich hatte eine nette Dankeskarte erwartet und war ganz erstaunt, als ich Belohnung in einer anderen und viel prosaischeren, aber nichtsdestotrotz nicht unwillkommenen Art fand: Kohle! Und zwar genau so viel, wie zwei der besten Karten fürs Münchner Konzert des Emerson – Quartett kosten würden! Ich hatte tagelang damit geliebäugelt, und jetzt waren die Würfel gefallen. Ich hatte mich um Streicher gekümmert, und dafür würden sich andere Streicher um meine Seele kümmern – und was für welche. Gleich am nächsten Morgen rief ich, noch im Bademantel, bei der Konzertagentur an und bestellte zwei Karten in der zweiten Reihe Mitte, direkt vor dem Quartett. (So was hatte ich noch nie gemacht. Macht ziemlich Spass, das auszusprechen!) Die gute Fee setzte uns wirklich brettlbreit vor die Notenständer – wir hatten zwei Spieler rechts, zwei links von uns und den sagenhaftesten, absolut optimalen Höreindruck. Möglicherweise waren akustische Gründe ausschlaggebend, aber die Musiker sassen auch noch ganz vorn an der Rampe, also höchstens zwei Meter von uns. In einem Klavierabend würde ich nie so einen Platz wählen, weil der Höreindruck zu direkt wäre. Ausserdem wäre es für mich kein Mysterium, was da vor sich geht, ich müsste nicht so genau hingucken. Bei Menschen, die ihren Ton selber produzieren, und noch auf so unglaublich zarte Art, bin ich endlos und nachhaltig fasziniert und muss alles auch genau sehen, nicht nur hören. Und ich will so nah wie möglich dran sein, um das Holz selber schwingen zu spüren.
Es ist ein Luxus, den man sich selten im Leben gönnt, aber ich bin so froh, dass wir es hier gemacht hatten: diese physische Nähe trug viel dazu bei, dass es eines der berührendesten und ergreifendsten Konzerte meines Lebens wurde. Es war schwere Kost – zwei späte Beethoven – Quartette, op. 132 und op. 130 mit der Grossen Fuge als Finale (von Beethovens Sekretär wurde op. 130 nicht zu Unrecht als das „Monstrum der Quartett – Musik“ bezeichnet). Der Gatte meinte bis zum letzten Moment, sie würden das Programm noch ein bisschen umstellen und ändern und eventuell was leichter Hörbares druntermischen, weil man das dem Publikum kaum zumuten könne, aber sie blieben erwarteterweise tough und puristisch. Gott sei Dank.
Es wurde eine Art Gottesdienst in der dämmrig – opulenten Atmosphäre des Jugendstiltheaters. Die Musen tanzten an den Wänden, die grossen Feuerschalen an den Seiten waren sanft von hinten erleuchtet, die ganze griechische Ausstattung lullte uns ein und hob uns aus dem Alltag. Und ich war vom ersten Ton an gebannt. Wahrscheinlich war es nicht so, aber gefühlt hielt ich für zwei Stunden den Atem an. Diese Musik ist so grandios, und es war einfach unglaublich, wie kultiviert und innig die vier Herren zusammenspielten. Wie ein Mensch. Und was für einen intensiven Klang sie manchmal selbst ohne Vibrato hinbrachten – das war herzzerschneidender als jeder zu üppig wabernde Ton.
 Bei aller Schönheit, Harmonie und Transzendenz war es partienweise auch ein wirklich schmerzhafter Abend. Warum tut man sich so was an? Kollektiv?! Hab mich mal wieder gefragt, welchen dionysischen Hintergrund solche Kulturveranstaltungen eigentlich haben, und die mythologische Dekoration grade dieses Theaters legt diese Frage nahe. Warum kommt man ordentlich angezogen und mit Omas Perlen um den Hals mit lauter Gleichgesinnten zusammen, in einer stark von Ritualen geprägten Umgebung, und lässt sich von ähnlich ordentlich gekleideten Individuen so komplett demontieren und bis ins Mark erschüttern? Lässt sich reduzieren auf das kümmerliche Häuflein sterblicher Mensch, das wir alle sind, obwohl wir äusserlich so gefasst wirken? Und gleichzeitig auf eine Art das Selbst verlieren, wie man es nur im Zustand höherer Erkenntnis tun kann? Und kein Mensch spricht ein Wort dabei, stundenlang!! Der Gipfel der – mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, obwohl es etwas zu harsch ist – Folter war dann, dass sie nach der Grossen Fuge einen schlichten Bach – Choral als Zugabe spielten, passenderweise „Vor Deinen Thron tret ich hiermit.“ Wen sie bisher noch nicht geknackt hatten, der war spätestens jetzt fällig.
Bei aller Schönheit, Harmonie und Transzendenz war es partienweise auch ein wirklich schmerzhafter Abend. Warum tut man sich so was an? Kollektiv?! Hab mich mal wieder gefragt, welchen dionysischen Hintergrund solche Kulturveranstaltungen eigentlich haben, und die mythologische Dekoration grade dieses Theaters legt diese Frage nahe. Warum kommt man ordentlich angezogen und mit Omas Perlen um den Hals mit lauter Gleichgesinnten zusammen, in einer stark von Ritualen geprägten Umgebung, und lässt sich von ähnlich ordentlich gekleideten Individuen so komplett demontieren und bis ins Mark erschüttern? Lässt sich reduzieren auf das kümmerliche Häuflein sterblicher Mensch, das wir alle sind, obwohl wir äusserlich so gefasst wirken? Und gleichzeitig auf eine Art das Selbst verlieren, wie man es nur im Zustand höherer Erkenntnis tun kann? Und kein Mensch spricht ein Wort dabei, stundenlang!! Der Gipfel der – mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, obwohl es etwas zu harsch ist – Folter war dann, dass sie nach der Grossen Fuge einen schlichten Bach – Choral als Zugabe spielten, passenderweise „Vor Deinen Thron tret ich hiermit.“ Wen sie bisher noch nicht geknackt hatten, der war spätestens jetzt fällig.
Ich war selten so erschüttert und durcheinandergerüttelt nach einem Konzert. Glücklicherweise, denn all zu oft würde man das nicht aushalten. Es war wirklich so eklatant, dass ich dachte: der Tag, an dem auf Konzertkarten Warnhinweise gedruckt werden, wird in Zeiten von „Die DVD startet möglicherweise von vorn“ oder „In Augsburg Hbf werden zwei Zugteile vereinigt. Es kann zu einer Erschütterung kommen.“ nicht mehr fern sein.
Mein Vorschlag für einen Beethoven – Abend mit den Emersons wäre: „Sie werden mit Ihrer eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Dies kann mit Schmerzen verbunden sein. Möglicherweise werden Sie jedoch einen Blick auf die ewige Wahrheit erlangen, in die Sie nach Ihrem Ableben eingehen. Sollten Sie bereit sein für solche Visionen, kann der Abend für Sie auch mit einem positiven Ausblick enden. Bitte vermeiden Sie es in der ersten Viertelstunde nach dem Konzert, ein Fahrzeug zu führen oder Maschinen zu bedienen.“
(Fotos: muenchenmusik, Alan Dornak)
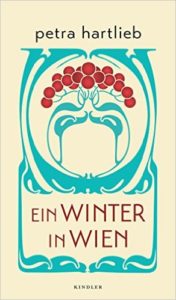 Vor Weihnachten habe ich mir zwei Bücher gekauft, die ich jetzt erst lesen konnte. Zufällig spielen beide im Winter, das eine zumindest zeitweise, und verlängern so meine Schneefreuden – die perfekte Januarlektüre! Und beide sind so atmosphärisch und verzaubernd, dass man sie nur lesen sollte, wenn man lange, ruhige Abende vor sich hat, an denen man nichts anderes mehr leisten muss. Einmal, um sie angemessen zu geniessen, und dann, weil grade Donna Tartts „Die geheime Geschichte“ ein Roman von der suchterzeugend – fesselnden Sorte ist, bei dem man ständig überlegt, wo man noch eine Minute hat, um weiterzulesen. So ein Roman, bei dem man in den drei Tagen, in denen man ihn verschlingt, aufhört, zu kochen oder sich sonst wie um anständiges Essen zu bemühen und die Frage, was es gibt, nur noch zwischen „schnell ein Brot in der Hand, während die andere das Buch hält“ und „ich ess morgen, das reicht auch noch“ pendelt. Die Sorte Buch, die einen mit Freuden zum Einzelgänger werden lässt, der nichts von der Welt draussen wissen will.
Vor Weihnachten habe ich mir zwei Bücher gekauft, die ich jetzt erst lesen konnte. Zufällig spielen beide im Winter, das eine zumindest zeitweise, und verlängern so meine Schneefreuden – die perfekte Januarlektüre! Und beide sind so atmosphärisch und verzaubernd, dass man sie nur lesen sollte, wenn man lange, ruhige Abende vor sich hat, an denen man nichts anderes mehr leisten muss. Einmal, um sie angemessen zu geniessen, und dann, weil grade Donna Tartts „Die geheime Geschichte“ ein Roman von der suchterzeugend – fesselnden Sorte ist, bei dem man ständig überlegt, wo man noch eine Minute hat, um weiterzulesen. So ein Roman, bei dem man in den drei Tagen, in denen man ihn verschlingt, aufhört, zu kochen oder sich sonst wie um anständiges Essen zu bemühen und die Frage, was es gibt, nur noch zwischen „schnell ein Brot in der Hand, während die andere das Buch hält“ und „ich ess morgen, das reicht auch noch“ pendelt. Die Sorte Buch, die einen mit Freuden zum Einzelgänger werden lässt, der nichts von der Welt draussen wissen will.
Es gibt kaum was gemütlicheres, als von verschneiten, bitterkalten Wintern in Vermont zu lesen, während man warm und gemütlich eingekuschelt auf dem Sofa liegt. Die Geschichte um sechs Collegestudenten, die quasi aus Versehen einen Mord begehen und ihn mit einem anderen vertuschen müssen, entwickelt sich gnadenlos und mit einem Sog, der weit über das Krimiartige hinausgeht. Es geht um Fragen der Moral, Schuld und Verantwortung. Je weiter die Handlung fortschreitet, desto mehr hat man das Gefühl, in einer griechischen Tragödie zu sein, die sich auf ein unausweichliches Ende zubewegt. Wem das zu dostojewskihaft oder philosophisch klingt: das ist es nicht (nur). Das fesselnde daran ist ja grade, dass diese Gruppe von Altgriechischstudenten exzentrisch, dekadent und elitär ist, das Ganze aber so alltäglich und detailreich beschrieben in den normalen amerikanischen Unialltag eingebettet ist, dass man kaum Distanz spürt. Im Gegenteil, man fragt sich: wo wäre ich da gestanden? Wie hätte ich gehandelt?
(Kleiner Exkurs: das Buch spricht mich auch auf besonders persönliche Weise an, weil es exakt in dem Jahr herauskam, in dem ich in Amerika studiert habe. Vieles an den Alltagsgegebenheiten erkenne ich wieder, und es gibt mehr als eine Parallele zu meinem Leben auf dem Campus des ländlichen Kleinstadt – Colleges, in dem ich studiert habe. Und wir waren sogar ein noch kleinerer Zirkel: nur drei Klavierstudenten um einen charismatischen, wohlgesonnenen und grosszügigen Professor, dem unsere allgemeine Erziehung und Bildung mindestens so am Herzen lag wie unsere handwerklich einwandfreie Ausbildung am Klavier. Und wie Camilla im Buch war ich das einzige Mädchen in einer Männergruppe und hab da ganz anders gelernt, mich zu behaupten. Deshalb meine grosse Faszination für den Roman, die andere vielleicht nicht nachvollziehen können – auf eine gewisse Art ist es eine Zeitreise für mich.)
 „Die geheime Geschichte“ ist aus den Neunziger Jahren und Donna Tartts erstes Buch. Ich war sicher, dass es verfilmt ist – der Stoff schreit geradezu danach – aber glücklicherweise hat sich noch niemand gefunden, der dazu bereit wäre. Es ist die Art Geschichte, in der man trotz Düsterkeit und Gruselelementen so lange wie möglich verweilen möchte. Und ein Film wäre viel zu schnell vorbei. Die Figuren sind komplex und differenziert beschrieben, und in einer sprachlichen Brillanz und Üppigkeit, die ihresgleichen sucht. Wie in ihrem sensationellen anderen Roman „Der Distelfink“ habe ich nach der Lektüre das Gefühl, dass ich jede der Gestalten selber schon lange kenne. Und mit einer Deutlichkeit und Intensität, wie man sie in Dickens – Romanen findet.
„Die geheime Geschichte“ ist aus den Neunziger Jahren und Donna Tartts erstes Buch. Ich war sicher, dass es verfilmt ist – der Stoff schreit geradezu danach – aber glücklicherweise hat sich noch niemand gefunden, der dazu bereit wäre. Es ist die Art Geschichte, in der man trotz Düsterkeit und Gruselelementen so lange wie möglich verweilen möchte. Und ein Film wäre viel zu schnell vorbei. Die Figuren sind komplex und differenziert beschrieben, und in einer sprachlichen Brillanz und Üppigkeit, die ihresgleichen sucht. Wie in ihrem sensationellen anderen Roman „Der Distelfink“ habe ich nach der Lektüre das Gefühl, dass ich jede der Gestalten selber schon lange kenne. Und mit einer Deutlichkeit und Intensität, wie man sie in Dickens – Romanen findet.
Es ist ein düsteres Buch übers Erwachsenwerden, aber ich würde es keinem Jugendlichen schenken.
„Winter in Wien“ von Petra Hartlieb hingegen ist zarte, unschuldige, märchenhafte Leküre, die man Vierzehnjährigen wie Grossmüttern gleichermassen unbedenklich schenken könnte. (Und ich muss zugeben: ich hab es wegen des ungeheuer dekorativen Jugendstil – Covers gekauft, und schon deshalb würde es sich als Geschenk wunderbar eignen.) Während die Figuren im anderen Roman prall voll Leben und Schrulligkeiten sind, bleiben die beiden Hauptpersonen hier relativ blass. Auch sie sind um die 20, wachsen aber in einem völlig anderen, entbehrungreicheren Umfeld auf. Ausserdem arbeiten sie und hätten weder das Bedürfnis noch die Zeit, sich zuzudröhnen oder bewusstseinserweiternde Bacchanale zu veranstalten: Marie ist Kindermädchen bei Arthur Schnitzler, Oskar Angestellter in einer Buchhandlung, in der sie sich auch kennenlernen.
Der kurze Roman spielt sich innerhalb weniger Tage 1911 in Wien ab. Bald ist Weihnachten, und es beginnt tatsächlich zu schneien. Bilder von schneebedeckten Parkflächen, leise fallenden Flocken und Schlittenausflügen mit den Kindern sind Balsam für die winterliebende Seele und ein passender Hintergrund für die zarte Geschichte. Es gibt kaum eine erwähnenswerte Handlung, aber ich denke, das war auch so geplant. Petra Hartlieb wollte wahrscheinlich einen kurzen Moment aus dem Leben im Umfeld Schnitzlers herausnehmen und wie unter einer Lupe Wiener Alltagsleben kurz vor Weihnachten zeigen, komplett mit dem ganzen Zubehör einer untergegangenen Zeit wie eben Dienstboten, Köchinnen, aufwendigen Abendessen und Kindermädchen, die selber zwar lesen können, aber noch nie in einer Buchhandlung waren. Alles könnte fast zu schlicht sein, wenn sie nicht den Moment herausgepickt hätte, der den Kern zu einer spannenden Entwicklung in sich trägt (die dann im Buch nicht mehr vorkommt…): Marie kommt in Kontakt mit der magischen Welt der Bücher und allem, wofür sie stehen können – Bildung, Weiterentwicklung, Weltflucht – , und man ahnt und hofft, dass sie nicht immer Kindermädchen bleiben wird. Diese Begegnung mit anderen Sphären deutet eine positive Entwicklung der Hauptfigur an. Man möchte gern erfahren, wie es ihr mit 30 geht, weil man schon ahnt, dass es nur angenehm und erfreulich sein wird. Hingegegen die überlebenden Studenten aus dem anderen Roman – ich weiss nicht… Sie sind schon mit Anfang 20 so exzessiv und haltlos, dass bei manchen der Absturz direkt vorprogrammiert ist. Das will man dann lieber gar nicht wissen. Auch in der Hinsicht hat „Winter in Wien“ was Märchenhaftes: sie werden glücklich bis an ihr Ende leben, man kann beruhigt das hübsche Buch zuklappen und die Nachttischlampe ausknipsen.
(Abbildungen: Kindler -Verlag, Goldmann – Verlag)
 Geplant war: ein schönes Festessen für die Familie am zweiten Weihnachtsfeiertag, ein opulentes Essen mit Freunden am Dreikönigstag mit Rezepten von der Titanic – weil danach alles vorbei ist und man lieber noch mal in Glanz und Gloria ein Fest feiert, als melancholisch und allein unter dem Christbaum zu sitzen. Dazwischen: viel Zeit zum Atemholen und Runterkommen nach einem ungewöhnlich arbeitsreichen Dezember. Vielleicht sogar Tage, an denen man lange schläft und danach nur lesend auf dem Sofa liegt.
Geplant war: ein schönes Festessen für die Familie am zweiten Weihnachtsfeiertag, ein opulentes Essen mit Freunden am Dreikönigstag mit Rezepten von der Titanic – weil danach alles vorbei ist und man lieber noch mal in Glanz und Gloria ein Fest feiert, als melancholisch und allein unter dem Christbaum zu sitzen. Dazwischen: viel Zeit zum Atemholen und Runterkommen nach einem ungewöhnlich arbeitsreichen Dezember. Vielleicht sogar Tage, an denen man lange schläft und danach nur lesend auf dem Sofa liegt.
Davor, am 22., wäre noch mein Schülerkonzert bei uns zuhause. 22 Schüler und danach ihre Eltern zum Tee und Lebkuchenessen – das ist der alljährliche Wahnsinn, nach dem das Erdgeschoss eine Grundreinigung braucht, aber darin hab ich schon Routine. Und danach hätte ich ja vermeintlich zwei Tage zum Ausspannen, bevor es weitergeht.
Das war der Plan.
Dann kam eine Silvester – Einladung, und kurz danach eine von neuen Freunden am 1. Januar um 13 Uhr, um das neue Jahr zu feiern. Dann unvermutet eine Kaffee – Einladung für den 2., und noch ungeplanter eine für den 4. Auch wenn Kaffee in München einen halben Tag Abwesenheit bedeutet – zu so netten Leuten will man nicht nein sagen, oder? Als ich nach meinem Schülerkonzert mit dem Staubsauger durchs Haus fegte, klingelte es: eine mir unbekannte Frau stellte sich als Mutter unseres jungen Nachbarn vor und erklärte, dass er nach einem lebensgefährlichen Unfall auf der Intensivstation in Salzburg liege und wir uns nicht wundern sollten, wenn sie hier aus und ein ging, sie sei jetzt über die Feiertage hier. Allein, fragte ich? Ja, dann solle sie doch den Heiligabend bei uns verbringen. Denn an Heiligabend allein sein mit solchen Sorgen – das muss ja nicht sein. Wieder im Haus betrachtete ich den Kater, der offensichtlich ein halb aufgegessenes Vanillekipferl unter dem Sofa gefunden hatte und auf dem Teppich damit spielte. Was hatte ich da grade gemacht?! (Aber: es war fast die schönste Einladung, weil sie sehr still und intensiv war und wir uns richtig gut unterhalten konnten mit der Unbekannten).
Am 23. unterrichtete ich bis abends, schaffte es aber davor und danach, gefühlt unsere verschiedenen Läden leerzukaufen. Was für ein Getümmel! War ich froh, dass ich’s hinter mir hatte!
Dachte ich.
 Denn am 24., drei Stunden vor Ladenschluss, rief der weihnachtsmuffelige Bruder an, der alle Einladungen strikt abgelehnt hatte, und erzählte eine phantasievolle Geschichte von einer Fliegerbombe ein paar Meter vor der Haustür und der Evakuierung der Augsburger Altstadt und noch so ein paar Märchen. Ich wollte sagen: sag doch einfach, dass euch langweilig ist und ihr nicht zum Einkaufen gekommen seid. Doch die Geschichte war so sorgfältig konstruiert, dass ich ihn nicht enttäuschen wollte. Also fiel die Augsburger Verwandtschaft am 25. ein, inklusive zwei Vierbeinern. Hätte ich das gewusst, hätte ich garantiert nicht so sorgfältig geputzt – Hunde nach einem Winterspaziergang sind ein Kapitel für sich..
Denn am 24., drei Stunden vor Ladenschluss, rief der weihnachtsmuffelige Bruder an, der alle Einladungen strikt abgelehnt hatte, und erzählte eine phantasievolle Geschichte von einer Fliegerbombe ein paar Meter vor der Haustür und der Evakuierung der Augsburger Altstadt und noch so ein paar Märchen. Ich wollte sagen: sag doch einfach, dass euch langweilig ist und ihr nicht zum Einkaufen gekommen seid. Doch die Geschichte war so sorgfältig konstruiert, dass ich ihn nicht enttäuschen wollte. Also fiel die Augsburger Verwandtschaft am 25. ein, inklusive zwei Vierbeinern. Hätte ich das gewusst, hätte ich garantiert nicht so sorgfältig geputzt – Hunde nach einem Winterspaziergang sind ein Kapitel für sich..
Kurzfassung: wir hatten vom 22. 12. bis 6. 1. sage und schreibe zehn Einladungen. So nett jede einzelne für sich war, so anstrengend war es letztlich. Aber ich war selber schuld: ich wollte grade zu dieser Jahreszeit aufgeschlossen und freundlich sein. Merkte aber danach: jedes „ja!“ zu einem anderen ist ein „nein“ zu mir selbst. Als dann nach Weihnachten der Schnee kam und ich immer wieder den Gehweg freischaufelte, dachte ich: so ist mein Leben jetzt. Ich schippe und schippe und schwitze, und dann schippe ich noch ein bisschen, um für zwei Stunden Durchblick zu haben. So waren der November und Dezember, als ich mich durch Berge von Arbeit und sehr viele Extrastunden schleppte, und so sind diese vermeintlichen Ferien, in denen ich nicht einen Mittagsschlaf halten konnte und mich fast täglich in Schale warf und auf den Weg zu einer Einladung machte.
Wo sind denn die Menschen, die immer bedauert werden, weil sie Weihnachten allein verbringen? Können wir bitte nächstes Jahr tauschen?!
Im Gegensatz zu früheren Weihnachten, die ich bewusst und leise zelebriert habe, habe ich dieses Jahr nur zwei Mal einen Funken von Ruhe und Frieden gespürt: einmal, als ich mit meiner Mutter nach einem Ausflug in der  Dämmerung und dann Dunkelheit im Aran – Café in Tegernsee sass, direkt am dunklen See und mit Blick auf die Lichter am anderen Ufer. Und das andere Mal jetzt, als die Schule schon wieder begonnen hatte und eine kleine Schülerin, die auf ihre Stunde wartete, völlig versunken und fast hypnotisiert vor meiner kleinen Weihnachtspyramide kniete und ganz still den Bäumchen beim Drehen zuschaute. Das hat mich selber ruhig gemacht und ein bisschen vom Zauber des Fests zurückgebracht. Wahrscheinlich darf man nicht ständige Glückseligkeit erwarten, sondern sollte dankbar sein für solche geschenkten Momente, die letztlich die Essenz des Ganzen in sich tragen.
Dämmerung und dann Dunkelheit im Aran – Café in Tegernsee sass, direkt am dunklen See und mit Blick auf die Lichter am anderen Ufer. Und das andere Mal jetzt, als die Schule schon wieder begonnen hatte und eine kleine Schülerin, die auf ihre Stunde wartete, völlig versunken und fast hypnotisiert vor meiner kleinen Weihnachtspyramide kniete und ganz still den Bäumchen beim Drehen zuschaute. Das hat mich selber ruhig gemacht und ein bisschen vom Zauber des Fests zurückgebracht. Wahrscheinlich darf man nicht ständige Glückseligkeit erwarten, sondern sollte dankbar sein für solche geschenkten Momente, die letztlich die Essenz des Ganzen in sich tragen.
Es waren verrückte Weihnachten, aber im Januar werde ich gar nichts machen. Wirklich gar nichts. Ausser Unterrichten, Additumsprüfungen begleiten, Montagskonzert begleiten, für beides üben, was das Zeug hält – aber die Wochenenden sind für mich. Und für ein wunderbares neues Magazin, das Fluchtpläne für die nächsten Weihnachtsferien aufkeimen lässt…
 Am Nikolausabend lief ich abends durch dichten Nebel zu Fuss runter in die Stadt. Meine desillusionierten Schüler versuchen ja immer wieder, mir weiszumachen, dass es keinen Nikolaus gibt, und noch jedes Jahr konnte ich ihnen ohne zu lügen sagen, dass es ihn sehr wohl gibt, weil ich ihn mit eigenen Augen gesehen habe. Bisher hatte ich jedes Jahr am Nikolaustag das Glück gehabt. Heuer dachte ich schon, ich müsste den gelten lassen, den ich drei Tage vorher in der Stadt entdeckt hatte, so am Samstagvormittag vor den Markthallen – was aber nicht das Gleiche ist, als ihn tatsächlich am 6. Dezember auf seiner wirklichen Mission zu erleben. Und wirklich, in dem Moment, in dem ich mir da auf meinem Weg dachte: „es wäre zu schön, wenn ich jetzt noch dem Nikolaus begegne“, kam eine rotgekleidete Gestalt mit Bischofsmütze und Stab aus dem Nebel einer Seitenstrasse. Und wartete sogar auf mich! Ich konnte seine Augen nicht erkennen vor lauter Rauschebart und weisser Haarpracht, aber er fragte, ob ich auch in die Stadt obi gehe, „na, da können wir ja gemeinsam gehen, mein Engerl konnte nämlich nur bis halb acht und jetzt muss ich noch Familien in der Altstadt besuchen.“ (Wie, Engerl mit Dienstschluss? Ich dachte, an solchen Tagen ist man rund um die Uhr im Einsatz?)
Am Nikolausabend lief ich abends durch dichten Nebel zu Fuss runter in die Stadt. Meine desillusionierten Schüler versuchen ja immer wieder, mir weiszumachen, dass es keinen Nikolaus gibt, und noch jedes Jahr konnte ich ihnen ohne zu lügen sagen, dass es ihn sehr wohl gibt, weil ich ihn mit eigenen Augen gesehen habe. Bisher hatte ich jedes Jahr am Nikolaustag das Glück gehabt. Heuer dachte ich schon, ich müsste den gelten lassen, den ich drei Tage vorher in der Stadt entdeckt hatte, so am Samstagvormittag vor den Markthallen – was aber nicht das Gleiche ist, als ihn tatsächlich am 6. Dezember auf seiner wirklichen Mission zu erleben. Und wirklich, in dem Moment, in dem ich mir da auf meinem Weg dachte: „es wäre zu schön, wenn ich jetzt noch dem Nikolaus begegne“, kam eine rotgekleidete Gestalt mit Bischofsmütze und Stab aus dem Nebel einer Seitenstrasse. Und wartete sogar auf mich! Ich konnte seine Augen nicht erkennen vor lauter Rauschebart und weisser Haarpracht, aber er fragte, ob ich auch in die Stadt obi gehe, „na, da können wir ja gemeinsam gehen, mein Engerl konnte nämlich nur bis halb acht und jetzt muss ich noch Familien in der Altstadt besuchen.“ (Wie, Engerl mit Dienstschluss? Ich dachte, an solchen Tagen ist man rund um die Uhr im Einsatz?)
 Und so kam es, dass ich neben dem Nikolaus den ganzen Köbingerberg runtergehen durfte. Stolz und ziemlich sprachlos. Manche Autos hupten, wenn sie uns sahen, und der Nikolaus hob grüssend seinen Bischofsstab, während er mir erzählte, dass er eigentlich Schreiner sei (?), dass so ne Mitra 60 Euro kostet (??), und dass er sich in Rosenheim jetzt noch ein weiss – goldenes Gewand mit goldener Mitra gekauft habe, einfach zur Abwechslung, denn er sei ja gestern auch schon unterwegs gewesen. Ich kam aus dem Staunen nicht raus. Vor allem das mit Rosenheim verwirrte mich – und wieso kaufen? Ich dachte, im Himmel kommt man ohne Geld aus? Das mit dem Schreinern verstehe ich auch nicht ganz, aber vielleicht braucht man in der Ewigkeit irgendein Hobby.
Und so kam es, dass ich neben dem Nikolaus den ganzen Köbingerberg runtergehen durfte. Stolz und ziemlich sprachlos. Manche Autos hupten, wenn sie uns sahen, und der Nikolaus hob grüssend seinen Bischofsstab, während er mir erzählte, dass er eigentlich Schreiner sei (?), dass so ne Mitra 60 Euro kostet (??), und dass er sich in Rosenheim jetzt noch ein weiss – goldenes Gewand mit goldener Mitra gekauft habe, einfach zur Abwechslung, denn er sei ja gestern auch schon unterwegs gewesen. Ich kam aus dem Staunen nicht raus. Vor allem das mit Rosenheim verwirrte mich – und wieso kaufen? Ich dachte, im Himmel kommt man ohne Geld aus? Das mit dem Schreinern verstehe ich auch nicht ganz, aber vielleicht braucht man in der Ewigkeit irgendein Hobby.
Nach zehn Minuten verabschiedeten wir uns höflich. Ich wollte ihn ja auf keinen Fall aufhalten, weil die Kinder langsam sicher ins Bett mussten. Aber ich blickte ihm nach, wie er langsam in den Nebelschwaden unserer gotischen Stadt verschwand, und ich war so glücklich: ich hatte den Nikolaus nicht nur gesehen, ich hatte mit ihm ein ganzes Stück zu Fuss gehen dürfen. Das ist wirklich und ehrlich nicht erfunden, so wahr ich hier sitze!
 Genau so plötzlich wie die Morgenluft auf einmal kühler wurde, hat sich ein anderes eindeutiges Anzeichen für den Herbst eingeschlichen, so schnell und immer wieder unerwartet, dass diese Phase auch schon fast vorbei ist: der Garten fängt an, golden zu leuchten. Selbst bei bedecktem Himmel, selbst in der Dämmerung: über allem liegt ein sanftes, warmes gelb-goldenes Leuchten. Es ist, als ob man in eine hohe, von innen und aussen strahlende Kathedrale eintritt. Das Strahlen hüllt einen auf unglaublich zarte Weise ein. Wie eine ganz leichte, aber wärmende Decke, die kaum spürbar über den Schultern liegt. Wie Wärme von innen nach einem heissen Tee mit Milch. Wie die Wärme von ganz innen, wenn man sich aufgehoben und geliebt fühlt. Das goldene Leuchten dringt in jeden Winkel des Gartens – selbst die schattigeren Stellen der Terrasse haben ihr eigenes Leuchten durch den gelbgefärbten Wein. Es ist allumfassend, wie dichter gelber Nebel, und gleichzeitig so persönlich und nah, dass ich nicht sicher bin, ob irgend jemand ausser mir es wahrnimmt. Und woher es kommt? Wir haben viele Laubbäume, darunter einen ausufernden, jetzt gelben Ahorn, und der Nachbar hat einen majestätischen Tulpenbaum, der grade strahlend gelb ist und seine Reflexe über den Gartenzaun wirft. Die Eichen hinterm Zaun werden kupferfarben, die Birke auch golden – es ist eine Symphonie in Gelb, die ihresgleichen sucht.
Genau so plötzlich wie die Morgenluft auf einmal kühler wurde, hat sich ein anderes eindeutiges Anzeichen für den Herbst eingeschlichen, so schnell und immer wieder unerwartet, dass diese Phase auch schon fast vorbei ist: der Garten fängt an, golden zu leuchten. Selbst bei bedecktem Himmel, selbst in der Dämmerung: über allem liegt ein sanftes, warmes gelb-goldenes Leuchten. Es ist, als ob man in eine hohe, von innen und aussen strahlende Kathedrale eintritt. Das Strahlen hüllt einen auf unglaublich zarte Weise ein. Wie eine ganz leichte, aber wärmende Decke, die kaum spürbar über den Schultern liegt. Wie Wärme von innen nach einem heissen Tee mit Milch. Wie die Wärme von ganz innen, wenn man sich aufgehoben und geliebt fühlt. Das goldene Leuchten dringt in jeden Winkel des Gartens – selbst die schattigeren Stellen der Terrasse haben ihr eigenes Leuchten durch den gelbgefärbten Wein. Es ist allumfassend, wie dichter gelber Nebel, und gleichzeitig so persönlich und nah, dass ich nicht sicher bin, ob irgend jemand ausser mir es wahrnimmt. Und woher es kommt? Wir haben viele Laubbäume, darunter einen ausufernden, jetzt gelben Ahorn, und der Nachbar hat einen majestätischen Tulpenbaum, der grade strahlend gelb ist und seine Reflexe über den Gartenzaun wirft. Die Eichen hinterm Zaun werden kupferfarben, die Birke auch golden – es ist eine Symphonie in Gelb, die ihresgleichen sucht.
Ich liebe es, in dieser Atmosphäre des langsamen Vergehens und Absterbens, die gleichzeitig maximale Schönheit ausstrahlt, die letzten Gartenarbeiten zu verrichten. Jetzt sind es nur noch langsame, vorsichtige Arbeiten. Im Sommer ist ja oft der radikale Kahlschlag notwendig, auch in dem Wissen, dass alles ohnehin wieder nachwächst, und schneller, als einem lieb ist. Die Arbeit ist schweisstreibend, die Hitze tut ein Übriges – es wäre albern, solche Aktivitäten nicht in passender Arbeitskleidung zu erledigen. Jetzt kann ich getrost in meinen Alltagsklamotten in den Garten gehen, denn auch das Tempo ist anders: es gibt nur noch wenig zu tun. Ich schaue, wer noch Zeit braucht zum sich ganz Einziehen, ganz zur Ruhe zu begeben. Ich will das Vergehen nicht beschleunigen, indem ich es mit der Schere beende – auch Welken braucht seine Zeit. Und das unglaubliche Farb – Crescendo der Bäume zeigt mir: wir sind auf dem Höhepunkt des Vergehens, aber es dauert noch ein paar Tage, bis das Ende wirklich da ist. Und die Zeit möchte ich ganz bewusst erleben und den mehrjährigen Pflanzen auch geben.
 Wie wir alle eingebunden sind in die Zeit… Ob wir es wollen oder nicht. Ich denke immer wieder über dieses seltsame Phänomen nach. Manchmal scheint sie sich rückwärts oder spiralförmig zu bewegen. Vor ein paar Tagen hab ich bei der Vorverkaufsstelle von München Ticket persönlich mehrere Karten abgeholt für Veranstaltungen fürs Literaturfest. Ich will mit verschiedenen Freundinnen gehen, also war es ein kleiner Stapel. Und der Herr an der Kasse fragte, ob oane vo uns no an Studentenausweis hat. Das ist mir echt lang nicht mehr passiert, und man ist erst mal perplex. Wir können alle nicht mehr nachweisen, dass wir noch studieren – aber irgendwie tun wir es doch, oder? Wenn wir das Programm des Literaturfests wälzen, die Neuerscheinungen verfolgen, davor ganz viel drüber reden, danach noch mehr, und jeder Besuch der Bücherschau einen Stapel an Neuanschaffungen nach sich zieht. Oder meine Notenbestellungen zum Schuljahresbeginn, für mich und für meine Schüler: das hat auf jeden Fall immer was von Schulanfang, mehr wissen wollen, weiterkommen – aber die Aufbruchsstimmung und der Wissensdurst ist nicht nur auf den Herbst beschränkt, sondern eigentlich ständiger Begleiter in meinem Leben. Und dem meiner Bekannten. Insofern sind wir noch Studenten und auch oft pleite wegen der Buchkäufe – aber wir kriegen auch immer mehr graue Haare und verdienen doch so viel, dass wir unseren Beitrag zur Kulturgesellschaft in Form von nicht ermässigten Eintritt leisten dürfen. An so was hab ich im herbstlichen, verwelkenden Garten gedacht – diese seltsame Gleichzeitigkeit von sich jung und neugierig fühlen, aber langsam definitiv auf den Herbst zugehen. Wahrscheinlich wird man noch mit 90 behaupten, im Herz eine Studentin zu sein.
Wie wir alle eingebunden sind in die Zeit… Ob wir es wollen oder nicht. Ich denke immer wieder über dieses seltsame Phänomen nach. Manchmal scheint sie sich rückwärts oder spiralförmig zu bewegen. Vor ein paar Tagen hab ich bei der Vorverkaufsstelle von München Ticket persönlich mehrere Karten abgeholt für Veranstaltungen fürs Literaturfest. Ich will mit verschiedenen Freundinnen gehen, also war es ein kleiner Stapel. Und der Herr an der Kasse fragte, ob oane vo uns no an Studentenausweis hat. Das ist mir echt lang nicht mehr passiert, und man ist erst mal perplex. Wir können alle nicht mehr nachweisen, dass wir noch studieren – aber irgendwie tun wir es doch, oder? Wenn wir das Programm des Literaturfests wälzen, die Neuerscheinungen verfolgen, davor ganz viel drüber reden, danach noch mehr, und jeder Besuch der Bücherschau einen Stapel an Neuanschaffungen nach sich zieht. Oder meine Notenbestellungen zum Schuljahresbeginn, für mich und für meine Schüler: das hat auf jeden Fall immer was von Schulanfang, mehr wissen wollen, weiterkommen – aber die Aufbruchsstimmung und der Wissensdurst ist nicht nur auf den Herbst beschränkt, sondern eigentlich ständiger Begleiter in meinem Leben. Und dem meiner Bekannten. Insofern sind wir noch Studenten und auch oft pleite wegen der Buchkäufe – aber wir kriegen auch immer mehr graue Haare und verdienen doch so viel, dass wir unseren Beitrag zur Kulturgesellschaft in Form von nicht ermässigten Eintritt leisten dürfen. An so was hab ich im herbstlichen, verwelkenden Garten gedacht – diese seltsame Gleichzeitigkeit von sich jung und neugierig fühlen, aber langsam definitiv auf den Herbst zugehen. Wahrscheinlich wird man noch mit 90 behaupten, im Herz eine Studentin zu sein.
 Und unser ständiges eigenes Fortschreiten in der Zeit, gegen das man gar nichts tun kann ausser es zu akzeptieren – daran hatte ich auch eine nette Erinnerung letzte Woche, als ein ernsthafter Schüler vor seinem Bach beteuerte, dass er wirklich jeden Tag dran gearbeitet hat, vor allem an der Artikulation links, dass es aber trotzdem noch nicht so klingt wie er es sich vorstellt. „Sie hören jetzt ein work in progress.“ Wie nett, dass er mich vorwarnte und sich immerhin ein Gewissen drum machte… Aber alles ist ständig ein work in progress. Mein Spielen, das Spielen meiner Schüler… Egal, was man tut – Musik machen, schreiben, malen, Geigenbauen, leben – es geht immer um den nächsten Schritt, um die nächst mögliche Verbesserung. Die Bäume müssen gelb werden und kahl, um nächstes Jahr neue Blätter bekommen zu können. Nichts ist statisch oder grossartig unter unserer Kontrolle. Da kann man sich nur entspannt einordnen in den grossen Ablauf der Dinge und sich daran freuen, dass man grade jetzt Teil von allem sein darf.
Und unser ständiges eigenes Fortschreiten in der Zeit, gegen das man gar nichts tun kann ausser es zu akzeptieren – daran hatte ich auch eine nette Erinnerung letzte Woche, als ein ernsthafter Schüler vor seinem Bach beteuerte, dass er wirklich jeden Tag dran gearbeitet hat, vor allem an der Artikulation links, dass es aber trotzdem noch nicht so klingt wie er es sich vorstellt. „Sie hören jetzt ein work in progress.“ Wie nett, dass er mich vorwarnte und sich immerhin ein Gewissen drum machte… Aber alles ist ständig ein work in progress. Mein Spielen, das Spielen meiner Schüler… Egal, was man tut – Musik machen, schreiben, malen, Geigenbauen, leben – es geht immer um den nächsten Schritt, um die nächst mögliche Verbesserung. Die Bäume müssen gelb werden und kahl, um nächstes Jahr neue Blätter bekommen zu können. Nichts ist statisch oder grossartig unter unserer Kontrolle. Da kann man sich nur entspannt einordnen in den grossen Ablauf der Dinge und sich daran freuen, dass man grade jetzt Teil von allem sein darf.
 Letztes Jahr im August war ich in der faszinierenden Etruskerausstellung in der Antikensammlung und war so begeistert und erfüllt, dass ich beim Rausgehen dachte: und nächste Woche geh ich endlich mal in die Glyptothek gegenüber. Ein Jahr später, immer noch keine Glyptothek… (Die Etruskerausstellung ist übrigens immer noch, falls jemand Lust hat.) Aber jetzt hab ich’s endlich geschafft! Auslöser war meine neue, langersehnte Kamera. Ich bin immer noch dabei, mich reinzufinden, und die Glyptothek sollte kein Vergnügungs-, sondern ein Übeausflug werden. Musste aber feststellen, dass ich ziemlich schlecht darin bin, wirklich viele Fotos zu machen. Es ist nicht natürlich für mich, durch die Linse zu gucken. Ich schaue wahnsinnig gern und bin eher in Gefahr, in manche Anblicke zu versinken und dann weiterzugehen, ohne ans Foto zu denken. Von daher war es kameramässig nur halb erfolgreich – aber ansonsten ein wunderbarer ruhiger Ferientag.
Letztes Jahr im August war ich in der faszinierenden Etruskerausstellung in der Antikensammlung und war so begeistert und erfüllt, dass ich beim Rausgehen dachte: und nächste Woche geh ich endlich mal in die Glyptothek gegenüber. Ein Jahr später, immer noch keine Glyptothek… (Die Etruskerausstellung ist übrigens immer noch, falls jemand Lust hat.) Aber jetzt hab ich’s endlich geschafft! Auslöser war meine neue, langersehnte Kamera. Ich bin immer noch dabei, mich reinzufinden, und die Glyptothek sollte kein Vergnügungs-, sondern ein Übeausflug werden. Musste aber feststellen, dass ich ziemlich schlecht darin bin, wirklich viele Fotos zu machen. Es ist nicht natürlich für mich, durch die Linse zu gucken. Ich schaue wahnsinnig gern und bin eher in Gefahr, in manche Anblicke zu versinken und dann weiterzugehen, ohne ans Foto zu denken. Von daher war es kameramässig nur halb erfolgreich – aber ansonsten ein wunderbarer ruhiger Ferientag.
Das Schönste an der Glyptothek vorweg: dass ich gleich beim Reingehen eine ehemalige Schülerin traf, die jetzt Latein studiert und mit ihrem Kurs dort war. Sie war wie immer, als wären nicht ein paar Jahre vergangen, und sie erzählte, dass sie sich einen hundert Jahre alten Flügel gekauft hat, der in ihrer Studentenwohnung steht, und dass sie fast jeden Tag spielt. Mission erfüllt, das Mädel ist auf dem richtigen Weg!
 Verglichen mit englischen Museen ist die Glyptothek nur mässig instruktiv – man erfährt aus den kostenlos zur Verfügung stehenden Informationen zum Beispiel gar nichts darüber, woher die Statuen kamen oder wer sie wann wo gefunden hat. Die ganzen spannenden Drumherumgeschichten haben mir gefehlt, denn die sind bei manchen Kunstwerken mindestens so interessant wie das, worum es bei der Darstellung eigentlich geht. Aber es sind sensationell schöne Stücke da versammelt. Hier, vor der Haustür. Muss man gar nicht nach Rom fahren… Ich bin immer wieder fasziniert und auch seltsam berührt von der Tatsache, was für eine Berg- und Talfahrt die Weltgeschichte und Kunstgeschichte so durchmacht. Dass es schon mal atemberaubend schöne und perfekte freistehende Statuen gegeben hat, dieses ganze Wissen dann Jahrhunderte (Jahrtausende…) verschüttet war und dann ein paar Florentiner Bildhauer mühsam diese Art, Kunst zu erschaffen, wieder ausgegraben haben. Für mich hat sich da ein wichtiges Puzzleteilchen in mein Halbwissen eingefügt. Man sagt immer so: „Wiederentdeckung der Antike“ – ohne wirklich zu wissen, was Antike bedeutet. Aber – siehe oben, ich habe nie den Drang gespürt, vielleicht einfach mal in München nach der Antike Ausschau zu halten.
Verglichen mit englischen Museen ist die Glyptothek nur mässig instruktiv – man erfährt aus den kostenlos zur Verfügung stehenden Informationen zum Beispiel gar nichts darüber, woher die Statuen kamen oder wer sie wann wo gefunden hat. Die ganzen spannenden Drumherumgeschichten haben mir gefehlt, denn die sind bei manchen Kunstwerken mindestens so interessant wie das, worum es bei der Darstellung eigentlich geht. Aber es sind sensationell schöne Stücke da versammelt. Hier, vor der Haustür. Muss man gar nicht nach Rom fahren… Ich bin immer wieder fasziniert und auch seltsam berührt von der Tatsache, was für eine Berg- und Talfahrt die Weltgeschichte und Kunstgeschichte so durchmacht. Dass es schon mal atemberaubend schöne und perfekte freistehende Statuen gegeben hat, dieses ganze Wissen dann Jahrhunderte (Jahrtausende…) verschüttet war und dann ein paar Florentiner Bildhauer mühsam diese Art, Kunst zu erschaffen, wieder ausgegraben haben. Für mich hat sich da ein wichtiges Puzzleteilchen in mein Halbwissen eingefügt. Man sagt immer so: „Wiederentdeckung der Antike“ – ohne wirklich zu wissen, was Antike bedeutet. Aber – siehe oben, ich habe nie den Drang gespürt, vielleicht einfach mal in München nach der Antike Ausschau zu halten.
 Dabei hätte es uns wirklich gutgetan, auch mal als Lateinabiturienten einen Abstecher ins Museum zu machen. Die Sammlung ist chronologisch angeordnet, und ziemlich gegen Ende, schon etwas voll von Eindrücken und müde vom Rumlaufen, fand ich mich ein einem Raum wieder mit Dutzenden Köpfen auf Stelen: die römischen Kaiser nach Christus starrten mich mit ihren leeren Marmoraugen an, alle dem Fenster und dem Licht zugewendet. Ein ganzes Rudel an eindrucksvollen Mienen. Ich liess mich auf die Bank in der Mitte fallen, alle im Blick, und dachte nur: „ach ne, ihr. Ausgerechnet. Was habt ihr mich Nerven gekostet und wie überflüssig war es, sich kurz vor dem Abi die Regierungsdaten von euch allen reinzupauken? Wo manche von euch so kurz regierten! Mann, das war klassisches überflüssiges Wissen, nur für die Prüfung gelernt und im Leben zu nichts zu gebrauchen. “ Ich fühlte mich tatsächlich besser nach dieser kleinen Abrechnung. Blieb noch ein bisschen sitzen, um die Gesichter anzuschauen, und merkte langsam: das sind ja alles einzelne Menschen. Individuen. Wahnsinnig ausdrucksvolle, edle, entschlossene, nachdenkliche Gesichter. Und dann will man von einem zum anderen gehen und fragen: was hast du richtig gemacht? Was hast du falsch entschieden? Warum hast du nur so kurz gelebt? Jeder einzelne dieser ollen Kaiser wird auf einmal unglaublich spannend, und es ist besonders berührend, ihnen so auf Augenhöhe gegenüber stehen zu können. Diese Verbindung hätte ich gebraucht damals in der Schule. Und es erinnert mich daran: ich brauch mehr Bildmaterial für meine Schüler. Wenn man mal gesehen hat, wie ein Kaiser, ein Komponist oder ein Pianist ausgesehen hat, stellt man andere Verknüpfungen her und verbindet wirklich etwas mit dem Namen. Und egal ob man Zuneigung oder Ablehnung empfindet – ist das Bild mal mit eigenen Emotionen in Berührung gekommen, gräbt es sich anders ins Gedächtnis ein.
Dabei hätte es uns wirklich gutgetan, auch mal als Lateinabiturienten einen Abstecher ins Museum zu machen. Die Sammlung ist chronologisch angeordnet, und ziemlich gegen Ende, schon etwas voll von Eindrücken und müde vom Rumlaufen, fand ich mich ein einem Raum wieder mit Dutzenden Köpfen auf Stelen: die römischen Kaiser nach Christus starrten mich mit ihren leeren Marmoraugen an, alle dem Fenster und dem Licht zugewendet. Ein ganzes Rudel an eindrucksvollen Mienen. Ich liess mich auf die Bank in der Mitte fallen, alle im Blick, und dachte nur: „ach ne, ihr. Ausgerechnet. Was habt ihr mich Nerven gekostet und wie überflüssig war es, sich kurz vor dem Abi die Regierungsdaten von euch allen reinzupauken? Wo manche von euch so kurz regierten! Mann, das war klassisches überflüssiges Wissen, nur für die Prüfung gelernt und im Leben zu nichts zu gebrauchen. “ Ich fühlte mich tatsächlich besser nach dieser kleinen Abrechnung. Blieb noch ein bisschen sitzen, um die Gesichter anzuschauen, und merkte langsam: das sind ja alles einzelne Menschen. Individuen. Wahnsinnig ausdrucksvolle, edle, entschlossene, nachdenkliche Gesichter. Und dann will man von einem zum anderen gehen und fragen: was hast du richtig gemacht? Was hast du falsch entschieden? Warum hast du nur so kurz gelebt? Jeder einzelne dieser ollen Kaiser wird auf einmal unglaublich spannend, und es ist besonders berührend, ihnen so auf Augenhöhe gegenüber stehen zu können. Diese Verbindung hätte ich gebraucht damals in der Schule. Und es erinnert mich daran: ich brauch mehr Bildmaterial für meine Schüler. Wenn man mal gesehen hat, wie ein Kaiser, ein Komponist oder ein Pianist ausgesehen hat, stellt man andere Verknüpfungen her und verbindet wirklich etwas mit dem Namen. Und egal ob man Zuneigung oder Ablehnung empfindet – ist das Bild mal mit eigenen Emotionen in Berührung gekommen, gräbt es sich anders ins Gedächtnis ein.